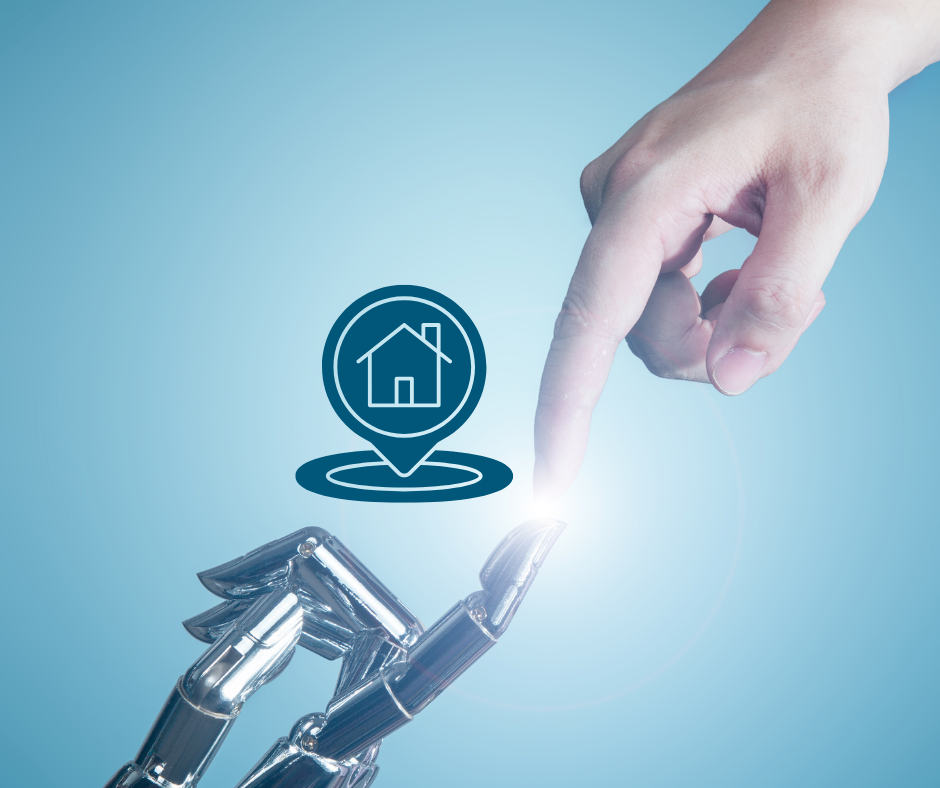Was ist die Rendite einer Immobilie?
Die Rendite zeigt wie rentabel eine Immobilie ist – also wie viel Ertrag sie im Verhältnis zu den investierten Kosten abwirft. Sie ist eine der wichtigsten Kennzahlen, wenn es um Kauf, Vermietung oder Kapitalanlage geht.
Aber: Rendite ist nicht gleich Rendite. Wer verstehen will, wie sich der tatsächliche Gewinn ergibt, sollte wissen, welche Art von Rendite gemeint ist.
Bruttorendite – die schnelle Orientierung
Die Bruttorendite wird oft als erste Einschätzung genutzt. Sie zeigt, wie hoch der Jahresertrag im Verhältnis zum Kaufpreis ist – ohne Nebenkosten, Steuern, Instandhaltung oder Modernisierung zu berücksichtigen.
Formel: Bruttorendite = (Jahresertrag ÷ Kaufpreis) × 100
Beispiel:
Eine Immobilie kostet 300.000 € und erzielt 12.000 € Ertrag pro Jahr.
→ Bruttorendite = 4 %.
Das klingt gut – sagt aber noch nichts darüber aus, ob sich die Investition am Ende wirklich lohnt.
Nettorendite – der realistische Blick
Die Nettorendite berücksichtigt auch laufende Kosten wie z. B. Verwaltung, Instandhaltungsrücklage, Leerstand oder nicht umlagefähige Nebenkosten. So wird sichtbar, wie viel Ertrag am Ende tatsächlich übrig bleibt.
Formel: Nettorendite = ((Jahresertrag – laufende Kosten) ÷ Gesamtkosten) × 100
Dabei umfassen die Gesamtkosten den Kaufpreis, die Kaufnebenkosten sowie ggf. geplante Modernisierungsmaßnahmen.
Typische Kosten & Annahmen
Um die Rendite realistisch zu berechnen, sollten folgende Posten unbedingt berücksichtigt werden:
- Kaufnebenkosten: Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und ggf. Makler – zusammen meist rund 10 % des Kaufpreises.
- Verwaltungskosten: Für die laufende Organisation und Betreuung der Immobilie – etwa 3–6 % der jährlichen Erträge.
- Instandhaltung & Rücklagen: Je nach Alter und Zustand des Objekts – im Schnitt 10–15 €/m² und Jahr.
- Leerstand oder Nutzungsausfall: Konservativ mit 1–3 % der Jahreserträge kalkulieren. Selbst in guten Lage kann es mal Leerstand geben.
- Modernisierung & Investitionen: Größere Maßnahmen, die den Wert erhalten oder steigern.
- Steuern & Abschreibung (AfA): Wirken sich auf die Nettorendite nach Steuern aus.
Je realistischer die Annahmen, desto verlässlicher die Rendite – und desto geringer die Überraschungen im laufenden Betrieb.
Was ist eine „gute“ Rendite?
Die Höhe einer Rendite hängt stark von Lage, Zustand und Objektart ab – und hat sich durch die Zinsentwicklung der letzten Jahre leicht verändert.
- In Toplagen (A-Städten) wie München, Hamburg oder Frankfurt liegen die Bruttorenditen 2025 meist zwischen 3,0 % und 3,5 % – stabil, aber mit geringem Risiko und hohen Kaufpreisen.
- In B- und C-Lagen (z. B. größere Mittelstädte oder Randlagen) sind 4,5 % bis 5,5 % üblich – teils auch darüber, allerdings mit mehr Unsicherheit bei Nachfrage, Leerstand und Wertentwicklung.
- In einfacheren oder ländlichen Märkten können zwar Renditen über 6 % erreicht werden, doch hier steigt das Risiko deutlich – etwa durch geringere Marktliquidität und schwerer planbare Mietentwicklung.
Entscheidend ist nicht allein die Zahl, sondern das Verhältnis von Ertrag zu Risiko.
Auch Faktoren wie Wertzuwachs, Inflationsschutz, Zinsniveau und steuerliche Effekte spielen eine wichtige Rolle bei der Gesamtbewertung.
Häufige Fehler – und wie man sie vermeidet
- Nebenkosten vergessen: Viele rechnen nur mit dem Kaufpreis. Doch Grunderwerbsteuer, Notar, Makler und Modernisierung gehören unbedingt dazu.
- Instandhaltung zu niedrig ansetzen: Gerade bei älteren Gebäuden sind Rücklagen für Dach, Heizung oder Fassade wichtig – sonst schmilzt die Rendite schnell dahin.
- Fluktuationsleerstand oder Mietausfall nicht einkalkulieren: Selbst in gefragten Regionen kann es Phasen ohne Ertrag geben. Eine Reserve schafft Sicherheit.
- Schönrechnerei mit Ertragserhöhungen: Index- oder Staffelmieten dürfen nur berücksichtigt werden, wenn sie realistisch sind – und der Markt das hergibt. Geplante Mieterhöhungen sollten z. B. nur in die Kalkulation einfließen, wenn sie marktkonform und rechtlich zulässig sind. Also sich im Rahmen von Mietspiegel, Kappungsgrenze und Mietpreisbremse befinden.
- Nur auf die Prozentzahl schauen: Eine hohe Rendite auf dem Papier nützt wenig, wenn das Risiko oder der Aufwand überproportional hoch sind.
Fazit
Die Rendite ist das Herzstück jeder Immobilienbewertung, aber nur ein Teil des großen Ganzen. Wer sie richtig versteht und richtig kalkuliert, kann Chancen besser einschätzen und Risiken minimieren. So wird aus einer Immobilie nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine solide Kapitalanlage.